Du musst Platz für Gott lassen!
Quincy Jones, einer der einflussreichsten Musiker des Jahrhunderts, über Big Bands, Bebop und die Kunst des Produzierens.
Der Musikproduzent Quincy Jones
Quincy Delight Jones jr., 1933 in Chicago geboren, gilt als einer der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts. Der amerikanische »Rolling Stone« hat ihm den Ehrentitel »Pate der schwarzen Musik« verliehen, obwohl sein Einfluss viel weiter reicht. Bereits als Schuljunge war er mit Ray Charles befreundet. Als ausgebildeter Trompeter hat er mit Charlie Parker und Lionel Hampton gespielt. Sein Ruf gründet aber vor allem auf seiner Tätigkeit als Komponist, Arrangeur und Produzent so unterschiedlicher Künstler wie Charles Aznavour, George Benson und Frank Sinatra. Endgültig zu einem Popstar gemacht hat ihn in den Achtzigern die Produktion der drei klassischen Michael-Jackson-Alben »Off The Wall«, »Thriller« und »Bad«. Jones, der sich als »Multimedia-Künstler« sieht, hat aber auch für Film und Fernsehen komponiert und einer Schule, dem Quincy Jones Performance Center in Seattle, seinen Namen gegeben. Einen Überblick über seine Aktivitäten bietet der Band »Quincy Jones. Mein Leben – meine Leidenschaften« (Edel 2011, 175 Seiten, 24,95 €). Wir treffen den Ruhelosen am Genfer See, im Salon Rotary des Montreux Palace, wo er residiert, wenn er seinem, je nach Zählung, Viert- oder Fünftjob als Talentförderer und Mitorganisator des Montreux Jazz Festival nachgeht. Zum Interview erscheint er in einer verschärften Variante des internationalen Golfhotel-Looks mit blauem Blazer, Segeltuchschuhen und Hut.
DIE ZEIT: Netter Hut.
Anzeige
Quincy Jones: Ich mag ihn. Ein Zuhälterhütchen.
ZEIT: So einen ähnlichen hatte Michael Jackson.
Jones: Das soll wohl ein Witz sein. Dieses Modell gab es bereits in den Dreißigern in Chicago, wo ich zur Welt kam. Getragen haben es Gangster.
ZEIT: Mit solchen Nieten an der Seite?
Jones: Mit allem Drum und Dran. Weit geschnittene Anzüge, Schuhe aus Alligatorleder, Diamanten im Zahn, alles schon da. Wir bewegen uns im Kreis, auch musikalisch. Bereits Count Basie hatte diesen Rhythmus, immer four to the floor, in den Siebzigern hieß das Gleiche dann Disco. Die Namen wechseln, but it’s the same old shit!
ZEIT: Sie wollten selbst einmal Gangster werden.
Jones: In den Dreißigern herrschten in Chicago Banden. Als Kind orientiert man sich an dem, was man kennt, und wir kannten nichts anderes. Es war die Zeit von Al Capone und seiner Gang, smarte, millionenschwere Jungs. Aber auf die schwarzen Gangs, für die mein Vater als Tischler arbeitete, waren sie nicht gut zu sprechen, sie trieben sie aus der Stadt. So kam ich mit meiner Familie 1943 in den Nordwesten, nach Seattle. Das war mein Glück.
ZEIT: Können Sie sich an Ihre erste Begegnung mit der Musik erinnern?
Jones: Ganz genau sogar. Mein Bruder Lloyd und mein Stiefbruder, wir klauten damals alles, was wir kriegen konnten. Eines Nachts brachen wir in eine Waffenfabrik ein, weil wir etwas von einer Lieferung Eiscreme gehört hatten. Beim Durchsuchen der Räume stand da im Dunkeln plötzlich ein Piano. Ich wollte die Tür zuerst wieder zumachen, aber dann hab ich es berührt. In dem Moment wusste ich, was ich den Rest meines Lebens tun würde.
ZEIT: Das klingt fast nach einer Bekehrung.
Jones: Ja, die Musik hat mich schwer getroffen.
ZEIT: Wie alt waren Sie da?
Jones: Elf Jahre! Aber von dem Moment an hab ich täglich nach der Schule geübt, nicht nur Klavier, sondern auch Rhythmusinstrumente, Saxofon, Trompete und Posaune – weil man mit einer Posaune bei Paraden vor allen anderen marschiert. Bald habe ich diese ganzen Instrumente in meinem Kopf gehört. Da wusste ich, dass ich nicht einfach ein Mitspieler sein würde, sondern auch Arrangeur, Komponist und Produzent.
ZEIT: Welche dieser Rollen ist Ihnen die liebste?
Jones: Schwer zu sagen, weil das eine immer das andere mit einschließt, und letztlich handelt es sich ja auch immer um dieselbe Person. Wenn man andere Musiker produziert, benutzt man automatisch das Wissen, das man als Arrangeur erworben hat. Man weiß einfach, wann etwas zu fett klingt, zu dünn, zu langsam oder die Tonart die falsche ist. Es hat mit Logik zu tun, aber auch mit jahrelangem Training.
ZEIT: Wie wichtig ist es, selbst ein Instrument zu spielen?
Jones: Absolut wichtig. Ich habe später bei Nadia Boulanger in Paris Komposition studiert, genau wie Leonard Bernstein und Igor Strawinsky, ich weiß, was ein Leitmotiv ist und ein Kontrapunkt. Aber Intellekt ist in der Musik nicht alles; was genauso zählt, ist die Praxis. Seattle in den Fünfzigern war eine Stadt mit so vielen Nachtklubs, dass du jeden Abend woanders spielen konntest.
ZEIT: Einer Ihrer Mitstreiter war Ray Charles.
Jones: Ray hab ich mit 14 kennengelernt, er war 16 und wie ein älterer Bruder zu mir.
ZEIT: Es gibt ein Foto, auf dem Sie neben Duke Ellington knien und zu ihm aufschauen.
Jones: Das war in den Siebzigern. Heute bin ich jemand, der gern redet, aber damals hab ich vor allem zugehört. Man konnte viel lernen von den alten Kriegern, Ben Webster, Lionel Hampton, Billy Eckstine. Count Basie war praktisch mein Ziehvater. Damals habe ich den Big-Band-Sound ein- und ausgeatmet, aber Bebop war genauso ein Einfluss. Nadia Boulanger sagte immer: »Jazzmusiker sind wie Wilde, sie nehmen sich die Musik, erst danach machen sie ihr den Hof und heiraten sie.« Das stimmt. Egal, mit wem ich später zusammengearbeitet habe, es ist immer beides, soul and science.
ZEIT: Heute kennen die meisten Sie als den Mann, der Michael Jackson produziert hat. Ärgert Sie das manchmal?
Jones: Eigentlich nicht, ich weiß es ja besser. Ich habe es als Segen empfunden, dass ich mit so großen Musikern zusammenarbeiten durfte, mit Billie Holiday, Sarah Vaughan, Aretha Franklin, Frank Sinatra oder eben Michael Jackson.
ZEIT: Erst die Arbeit mit Michael Jackson hat Sie zu einem reichen Mann gemacht.
Jones: Das stimmt. Aber das war nicht unser Hauptziel. Es ging einfach darum, das beste musikalische Ergebnis zu erzielen.
ZEIT: Was muss ein guter Produzent können?
Jones: Zunächst einmal muss er den Künstler in dem, was ihn ausmacht, respektieren, verstehen und lieben, sonst kann nichts Außergewöhnliches entstehen. Er muss die richtigen Mitspieler aussuchen und an die richtige Stelle setzen. Er muss aber auch dazu in der Lage sein, im Studio passende Worte für jeden zu finden. Ein guter Produzent ist wie ein guter Filmregisseur: Er überwacht den gesamten kreativen Prozess.
ZEIT: Klingt anstrengend.
Jones: Das ist es. Man ist technischer Leiter, Kindermädchen, Bruder und Hebamme zugleich.
ZEIT: Ist man mehr Handwerker oder mehr Künstler?
Jones: Eins bedingt das andere. Produzieren ist wie Malen. Erst hat man eine Skizze, und wenn die Linien stehen, kommt das Öl.
ZEIT: Spielen Drogen dabei eine Rolle?
Anzeige
Jones: Sind Sie verrückt? Wir haben oft die Nächte durchgearbeitet. Mit Drogen hätten wir das gar nicht durchgehalten.
ZEIT: Beatles-Produzent George Martin behauptet, jeder im Studio sei bekifft gewesen. Lucy In The Sky With Diamonds bedeutet nicht zufällig LSD.
Jones: Ich wette, George war dabei der einzige Nüchterne.
ZEIT: Ist man als Produzent selbst ein Star?
Jones: Nur bei seiner eigenen Musik. Bei den Alben anderer kommt es darauf an, den Star in seiner Vision zu unterstützen. Falls er eine hat. Manche haben keine Ahnung, wo sie hinwollen, besonders am Anfang.
ZEIT: Führt so viel Macht in Versuchung?
Jones: Nicht, wenn man mit dem, was man tut, am Boden bleibt.
ZEIT: Es heißt, Sie hätten Ihren Musikern im Studio oft Anweisungen nach Art eines Küchenchefs gegeben: Mach es heiß! Mach es knusprig! Was haben Sie zu Michael Jackson gesagt?
Jones: Auch nur das Übliche: ’n bisschen fettiger an der Stelle, ’n bisschen mehr funky. Oder umgekehrt: Nimm das Tempo raus, ’n bisschen weniger dramatisch das Ganze, mehr in the pocket.
ZEIT: Für Michael Jackson haben Sie im Studio extra ein Podest gebaut.
Jones: Wir wollten es ihm ermöglichen, während der Aufnahme zu tanzen. Wir haben alle Lichter ausgemacht mit Ausnahme eines Spots direkt aufs Mikrofon, sodass Michael im Raum herumwirbeln konnte. Alles war dunkel, nur zu den Gesangspassagen sahen wir sein Gesicht hinter der Scheibe auftauchen.
ZEIT: Sie haben einmal gesagt, Michael Jackson sei für Sie »großes Kino«.
Jones: Er hatte diese Tendenz zum Theatralischen. Und er brauchte die Bühne, um seine Fantasien auszuleben. Es hatte etwas Kathartisches, manchmal hat er im Studio geweint. Umso wichtiger war es, dass er sich wohlfühlte.
ZEIT: War er kompliziert?
Jones: Überhaupt nicht. Er kam immer gut vorbereitet und war in allem, was er tat, sehr engagiert.
ZEIT: Anfangs hieß Produzieren, Musik aufs Band zu bringen. Mit Ihrer Arbeit für Michael Jackson wurde das Studio endgültig zum Labor.
Jones: Ja, aber die Technik dazu mussten wir selbst entwickeln. Für den Sound koppelte Bruce Swedien mehrere analoge Bandmaschinen aneinander und brachte sie auf exakt die gleiche Geschwindigkeit, sodass wir die Möglichkeit hatten, 16, 20, 24 Spuren getrennt aufzunehmen und erst später abzumischen. Wir nannten das Ganze »Accusonic Recording Process«.
ZEIT: Ein bombastischer Name.
Jones: Es ist eine Verbindung von accurate und sonic und sollte für die Sorgfalt stehen, mit der wir die einzelnen Schichten auftrugen. Später bot man uns eine Menge Geld dafür, man dachte, es handle sich um ein kleines schwarzes Kästchen. Dabei war es einfach ein Begriff für die Magie, die wir empfanden.
ZEIT: Wie weiß man, wann etwas richtig klingt?
Jones: Man muss eine Vorstellung vom fertigen Klangbild in sich tragen. Im entscheidenden Moment muss man aber auch loslassen können. Meine Erfahrung ist: Es geht durch dich hindurch. Ich sage immer: Lass Platz, damit Gott durch den Raum gehen kann.
ZEIT: Heute entsteht Musik meist am Computer. Was halten Sie von Produktionssoftware wie ProTools, Cubase oder Logic?
Jones
 lächelt dünn) So was benutzen wir nicht. Nie. Bei heutigen Produktionen hört man oft, wie in den mittleren Frequenzen Druck reingepumpt wird, damit es dreckig klingt. Es klappt aber nicht, weil das eine rein technische Angelegenheit ist. Hören Sie sich dagegen Billie Jean an, oder Give Me The Night von George Benson. Nein, verglichen mit ProTools ist unser Sound noch immer the real stuff.
lächelt dünn) So was benutzen wir nicht. Nie. Bei heutigen Produktionen hört man oft, wie in den mittleren Frequenzen Druck reingepumpt wird, damit es dreckig klingt. Es klappt aber nicht, weil das eine rein technische Angelegenheit ist. Hören Sie sich dagegen Billie Jean an, oder Give Me The Night von George Benson. Nein, verglichen mit ProTools ist unser Sound noch immer the real stuff.ZEIT: Waren die 24 separaten Spuren nicht schon die Vorwegnahme des Heimstudios?
Jones: Nein, der Unterschied ist: Wir hatten unsere Sache von Grund auf gelernt. Bruce Swedien und ich wussten um die Beschaffenheit von Klängen, die Obertöne, alles, worauf es bei einer guten Aufnahme ankommt.
ZEIT: Wird heute im Studio zu vieles mit zu vielem vermischt?
Jones: Mich wundert oft, wie kurz das Gedächtnis ist. Die meisten wissen gar nicht mehr, wie tief Popmusik im Jazz verwurzelt ist, sie wursteln einfach drauflos. Dabei kann man nur brillant sein, wenn man die ganze Geschichte kennt.
ZEIT: Im Sampling kehrt viel Geschichte wieder.
Jones: Heißt das, dass diese Leute sich auskennen? Nehmen Sie Hip-Hop, das ist im Grunde wie Bebop, das ist Jazz, die Wurzeln liegen in Afrika, bei den Griots, die auf Hochzeiten Geschichten erzählten. Die meisten Rapper wissen das nicht.
ZEIT: Von welchen Leute ist die Rede? Von Timbaland oder den Neptunes?
Jones
 legt den Finger an die Lippen, als wolle er sagen: Der wahre Gentleman schweigt)
legt den Finger an die Lippen, als wolle er sagen: Der wahre Gentleman schweigt)ZEIT: Was würden Sie jungen Musikern raten?
Jones: Seid offen, neugierig, und vertraut euren Instinkten. Wenn dann noch harte Arbeit hinzukommt, kann nichts schiefgehen. Das Letzte, was von unserem Planeten verschwinden wird, sind Wasser und Musik
Edit: Wie die Smilies in den Text gekommen sind weiß ich nicht. Keine Absicht und bekomme sie auch nicht entfernt.





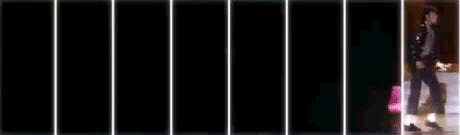






Kommentar