Das Studio ist ein heiliger Ort, sagt der Musikproduzent Quincy Jones. Und: Die Künstler, mit denen man arbeitet, muss man lieben
Das Hotelzimmer im 15. Stock eines Westberliner Luxushotels ist zugestellt mit Werbetafeln für einen neuen AKG-Kopfhörer, als dessen Markenbotschafter Quincy Jones eine kleine Europareise unternimmt. "Was sind Sie für ein Sternzeichen?", ruft Quincy Jones zur Begrüßung - ein Berg von einem Mann mit einer tiefen, vernuschelten Stimme. "Schütze", antworte ich. Das sei gut, kontert der vielleicht bedeutendste Musikproduzent des 20. Jahrhunderts, denn auch Sinatra sei im Dezember geboren, und mit dem sei er durch dick und dünn gegangen. Ebenso mit Ella Fitzgerald, Ray Charles, Sammy Davis Jr. und natürlich Michael Jackson. Quincy Jones, berühmt geworden als Jazzer, Soundtrack-Komponist und Orchesterarrangeur, war der Architekt der Welterfolge "Thriller" und "Bad".
Welt am Sonntag: Mr. Jones, von Ihnen stammt der berühmte Ausspruch: "Ich bin jedem Freak in diesem Geschäft begegnet."
Quincy Jones: Das habe ich nie gesagt.
Welt am Sonntag: Doch, erst kürzlich, in einem Interview unmittelbar nach Michael Jacksons Tod.
Jones: Dann habe ich es wohl auf ihn bezogen. Aber nicht auf Frank Sinatra. Frank war wie ein Felsen.
Anzeige
Welt am Sonntag: Muss der Mensch aus Fels sein, um erfolgreich zu sein?
Jones: Ja, sonst werden Sie zerrieben. Ich musste ohne meine Mutter aufwachsen. Da lernt man, wie man überlebt. Man lernt durch das Überleben selbst. Man lernt durch die Fehler, die man macht. Einige der besten Melodien sind aus Versehen entstanden, weil jemand eine Note falsch notiert hat oder weil man Zeilen in der Orchestrierung verwechselt oder ein Textblatt einer falschen Melodie zuordnet.
Welt am Sonntag: Fehler zuzulassen erfordert eine andere Denkweise als jene, die einen in der Schule und an der Universität gelehrt wird.
Jones: Meine Schule war der Jazz. Im Jazz, der einerseits auf klaren Regeln basierte, war es andererseits erlaubt, die Regeln zu brechen. Im Jazz ging es nicht um Geld und nicht um Ruhm. Zumindest ich habe mich um beides nie gekümmert.
Welt am Sonntag: Was war stattdessen Ihr Ziel?
Jones: Ich wollte stets immer nur weiter arbeiten können. Meinen Weg unbeirrbar fortsetzen. Das ist auch heute noch das Beste, was man tun kann. Lionel Hampton lud mich mit 18 ein, auf einer Tournee Trompete zu spielen. All die älteren Musiker, denen ich in dieser neuen Welt begegnete, waren kosmopolitan, sie reisten viel, sie waren smart und lustig - und nicht zuletzt beherrschte jeder von ihnen ein Instrument.
Welt am Sonntag: Welche Rolle spielte die Virtuosität?
Jones: Die Disziplin der Virtuosität war der Gegenpol zur mentalen Freiheit. Nur wer mit Disziplin sein instrumentales Können pflegte, konnte dem mitunter selbstzerstörerischen Lebensstil etwas entgegensetzen. Die Wiege der Disziplin waren die hierarchisch organisierten Bands. Charlie Parker und Dizzy Gillespie kamen beide aus einer Big Band. Auch Miles Davis ging durch die Lehre einer Band, bevor er berühmt wurde. Wir reden von Überschreibungen und Beeinflussungen. Im Jazz geht es wie im Leben immer um die Frage: Bin ich bereit, in den Schuhen meiner Vorbilder, der Giganten, zu laufen? Denn eins ist klar: Niemand wird die Musik neu erfinden. Wir können nur irgendwo anknüpfen.
Welt am Sonntag: Wollen Sie damit also sagen, dass die Basis allen Schaffens Respekt sein sollte?
Jones: Bescheidenheit und Respekt - gegenüber der Geschichte und gegenüber den Ahnen. Das sind die goldenen Regeln. Und: Vergiss das Streben nach dem Erfolg.
Welt am Sonntag: Interessant: Die meisten berühmten Menschen, obgleich ehrgeizig, behaupten stets, dass der Erfolg nie ihre Antriebsfeder gewesen sei.
Jones: Das ist kein Widerspruch. Gehen wir einmal davon aus, dass der Mensch nach Glück strebt. Schon die Weisen aller Weltreligionen wussten, dass man das Glück im Einklang mit Gott findet - und die Talente, die uns gegeben wurden, Gottesgaben sind. Dass Menschen mit Talent alsdann andere Menschen zu verzaubern imstande sind - das verwundert mich nicht. Nicht wenige Jazzer warfen mir vor, dass ich mich ausverkaufen würde, als ich Michael Jackson zu produzieren begann.
Welt am Sonntag: Und, war es Ausverkauf?
Jones: So ein Quatsch! Wynton Marsalis war der lauteste unter den Kritikern. Dann hat er ein Album mit Willie Nelson aufgenommen. Da lache ich laut! Bei Michael habe ich die DNA des Rhythm 'n' Blues den neuen Zeiten angepasst. Daran ist nichts auszusetzen. Alle waren sich einig, dass er den Zenit seiner Karriere mit dem Ende der Jackson Five erreicht habe. Mein Job war es, all diesen Kritikern das Gegenteil zu beweisen.
Welt am Sonntag: Wie viel brachte Michael Jackson in seine eigenen Songs ein?
Jones: Michael war ein sehr guter Zuhörer. Er hat zwar nur zwei Songs auf seinem ersten Album "Off the Wall" selbst geschrieben. Aber er war während der gesamten Sessions anwesend und hat alles in sich aufgesogen. Er war ein sehr disziplinierter Sänger. Er machte, was ich ihm sagte.
Welt am Sonntag: Wie sahen Anweisungen von Ihnen gegenüber Michael Jackson aus?
Jones: Beispielsweise bat ich ihn, mit der alten Motown-Tradition zu brechen, stets nur hoch zu singen - so singt Stevie Wonder bis heute. Man kann es gut hören auf "Don't Stop Till You Get Enough". Da bat ich Michael, dem hohen Gesang improvisierte, tiefere Gesangslinien entgegenzusetzen. Er wehrte sich erst ein wenig, aber dann probierte er es. Und da sah er dann ein, dass es ein guter Rat war.
Welt am Sonntag: Wie wichtig ist es, bewusst mit Traditionen zu brechen?
Jones: Mit Traditionen zu brechen ist nicht nur spannend. Es hat oft auch etwas sehr Natürliches, Naheliegendes. Dass Michael auf mein Drängen hin zum ersten Mal in einer tieferen Lage sang, bedeutete für ihn vor allem, in der ihm am besten liegenden Stimmlage zu singen.
Welt am Sonntag: Sie waren für Michael Jacksons Welterfolge verantwortlich. Ist man da gut beraten, eine Arbeitsbeziehung auf Distanz zu wahren?
Jones: Sie haben eine vollkommen falsche Vorstellung vom Berufsbild des Produzenten. Es gibt im Musikbusiness kein engeres, kein intimeres Verhältnis als das zwischen einem Sänger und seinem Produzenten. Als Sänger muss man sich in Vertrauen fallen lassen können. Ich nenne es Liebe. Und ich habe nicht ein einziges Mal in meinem Leben mit Sängern gearbeitet, die ich nicht geliebt habe. Es kann auch sonst gar nicht funktionieren. Stellen Sie sich vor, was passiert wäre, wenn Michael nach seiner Karriere mit den Jackson Five an einen Produzenten geraten wäre, der ihn nicht geliebt hätte! Nur Michaels Vertrauen in mich ist es zu verdanken, dass er zu Beginn seiner Solokarriere volles Risiko gegangen ist.
Welt am Sonntag: Die Verantwortung für seine Karriere lag bei Ihnen?
Jones: Natürlich! Aber anders als Angst ist Liebe ein guter Ratgeber: Jeder Vorschlag, der von mir kam, wie radikal auch immer, diente stets nur dem einen Ziel, sein Album noch besser zu machen, als es uns unter normalen Umständen möglich gewesen wäre. Nicht umsonst bezeichne ich die Musikstudios übrigens als Kathedralen - als heilige, geweihte Orte. Und aus genau diesem Grunde habe ich auch kein Tonstudio zu Hause. Ich will keine Gitarristen in Unterwäsche um drei Uhr morgens im Studio sehen. Nicht an einem heiligen Ort.
Welt am Sonntag: Was macht ein Musikstudio zu einem so besonderen Ort?
Jones: Es entsteht dort Musik, die im Idealfall die Welt verändern kann. An eine solche Aufgabe muss man mit vollem Ernst gehen. Und jeder, der behauptet, eine Platte produzieren zu können, die Dutzende von Millionen Einheiten verkaufen wird, der lügt. Den Erfolg kann man nicht planen. Man kann lediglich mit einer ebenso ernsthaften wie von Liebe geprägten Produktion ein Album aufnehmen, das einem möglichen Welterfolg nicht im Weg steht.
Welt am Sonntag: Haben auch Sie etwas von Michael Jackson gelernt?
Jones: Nein. Darum ging es auch gar nicht. Mein Job war unmissverständlich einseitig ausgerichtet.
Welt am Sonntag: Hören Sie, um sich inspirieren zu lassen, auch Arbeiten heutiger Produzenten?
Jones: Natürlich. Ich höre gerne Akon und Dr. Dres Produktionen von Ice Cube, 2Pac und Snoop Dogg. Der HipHop markiert die letzte große Revolution in der Musik. 1985 traf ich LL Cool J. Er fragte mich: "Mr Jones, wie denken die Musiker und Sänger über uns?" Ich fand diese Selbsteinschätzung ebenso bemerkenswert wie richtig, liegen die Wurzeln des HipHop doch nicht im Gesang oder im Beherrschen eines Instruments, sondern in der Tradition der afrikanischen Geschichtenerzähler. Der Schriftsteller Alex Haley schrieb in seinem Roman "Roots" über die Griots: "Immer wenn einer von ihnen starb, war es, als sei eine Bibliothek voller Bücher abgebrannt." Es gab zu jeder Zeit stets 30 oder 40 Griots, welche die Geschichte ihres Landes in ihrem Inneren trugen und mündlich weitergaben. Dieses Verständnis von Geschichtsschreibung liegt dem Rap zugrunde. Und deshalb haben die Rapper auch das Erbe des Jazz angetreten.





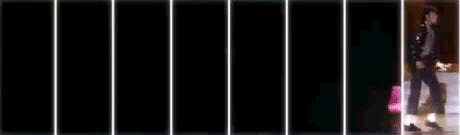




 Dass Michael keine Marionette und ganz sicher nicht austauschbar war - und überhaupt musikalisch ein Genie - wird wohl kaum einer anzweifeln. Selbst wenn ein Quincy Jones sowas vielleicht andeutet. Ich kenne keinen, auch von denen, die Michael nicht mögen, der ihm sein musikalisches Genie abspricht.
Dass Michael keine Marionette und ganz sicher nicht austauschbar war - und überhaupt musikalisch ein Genie - wird wohl kaum einer anzweifeln. Selbst wenn ein Quincy Jones sowas vielleicht andeutet. Ich kenne keinen, auch von denen, die Michael nicht mögen, der ihm sein musikalisches Genie abspricht.
Kommentar